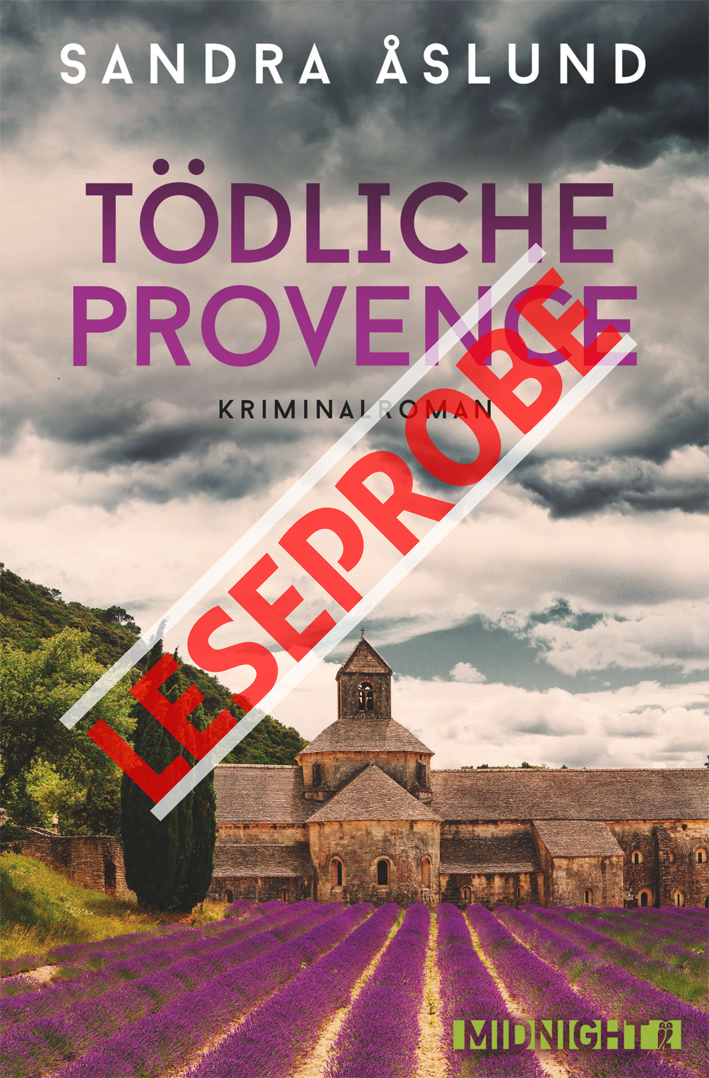Kapitel 1
Dienstag, 9. Oktober
Von der Küste war im Laufe des Nachmittags dichter Nebel ans Land gekrochen und hüllte alles ein, als hätte jemand die Insel in Watte gepackt. Johan orientierte sich an den weißen Stämmen der Birken, die den Weg flankierten. Sämtliche Umrisse von Bäumen, Sträuchern und dem mannshohen Farnkraut, das überall im Unterholz wucherte, verschluckte das undurchdringliche Grau.
Andächtig schritt er den gewundenen Trampelpfad entlang, quer durch den herbstlichen Mischwald, und sog die kühle, feuchte Luft in seine Lungen. Zart legten sich Wassertröpfchen auf sein Gesicht wie ein fein gesponnenes Netz. Eine sanfte Erfrischung, die die Natur als Geschenk für Spaziergänger bereithielt. Wie sie ohnehin unzählige Gaben darbot, an denen die Menschen für gewöhnlich achtlos vorbeiliefen.
Johan blieb stehen, bückte sich und hob einige Kastanien auf, die zu seinen Füßen lagen. Er steckte sie in den Lederbeutel, der an seinem Gürtel baumelte, und setzte seinen Weg durch den Wald fort.
Im Nebel, der eine natürliche Anonymität schuf, fühlte er sich wohl. Er verbrachte gern Zeit mit sich selbst. Die meisten Leute empfand er als anstrengend, und die meisten Worte waren so- wieso überflüssig.
Wenn Johan an den Nachmittagen in seiner Lieblingsecke in Mormors Stenungsbageri saß, seinen grünen Tee mit einem Stück Kuchen oder einer hausgemachten Kardemummabulle vor sich, und an seinen Gedichten arbeitete, beobachtete er ab und an die anderen Gäste. Sie gingen sicher davon aus, er sei so in sein Notizbuch vertieft, dass er ihre Gespräche nicht mitbekam. Doch sie irrten sich. Johans Ohren sogen die Sätze instinktiv auf und bestätig- ten ihm jedes Mal aufs Neue: Die meisten Unterhaltungen waren reine Zeitverschwendung. Hörten sich die Leute eigentlich selbst zu, was da an Banalitäten und negativem Müll aus ihren Mündern quoll?
Auf einen solchen Austausch legte Johan keinen Wert. Im All- gemeinen war er sich selbst genug. Wenn ihm nach Gesellschaft war, rief er seine Cousine Tindra an. Sie lebte in Singapur und stellte ebenso wie er eine Ausnahme in ihrer ansonsten so konservativen Familie dar. Oder er traf sich mit Rutger. Der Organist war in sein gutbürgerliches Leben auf dem Festland verflochten und floh lediglich ab und zu, um mit ihm sein wahres Ich auszuleben. Johan passte ihre sporadische Beziehung sehr gut so, wie sie war, mehr Nähe brauchte er nicht.
Die Nebelkulisse schluckte alles um ihn herum, doch Johan wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Bald lichtete sich der Wald, und schemenhafte Umrisse würden sich aus der grauen Suppe herausschälen.
Keine Viertelstunde später war es so weit: Riesige Mauern erhoben sich vor Johan. Schloss Borgholm, die mächtigste Ruine des Nordens. Selbst bei Sonnenschein strahlte sie etwas Düsteres, ja Bedrohliches aus. Kein Wunder, bei all den Schlachten, die hier stattgefunden hatten. Bei all dem Grauen, das geschehen war. Die Legenden, die sich die Öländer erzählten, waren voll davon.
Vier wuchtige Rundtürme markierten den quadratischen Grundriss der dreistöckigen Anlage, in der sämtliche Fenster und Dächer fehlten. Als wäre es gestern gewesen, erinnerte sich Jo- han, wie er zum ersten Mal einen Blick auf Schloss Borgholm erhascht hatte. Viele Jahre war es her, er hatte noch im Kindersitz hinten im Auto zwischen seinen beiden älteren Schwestern ge- sessen und neugierig durch die Windschutzscheibe nach draußen gespäht. Beim Anblick der imposanten Burgruine hatte sich ihm eine völlig neue Welt eröffnet. Dass es solche Bauwerke gab! Fortan hatte er, wann immer sie am Strand waren, versucht, Schloss Borgholm mit Eimer, Schaufel und riesigen Mengen an nassem Sand nachzubauen.
Um diese Uhrzeit war die Ruine für offizielle Besichtigungen geschlossen. Aber Johan war auf dem Gelände wie zu Hause und hatte irgendwann einen geheimen Gang entdeckt, der vom Wald unterhalb der Felsen, auf denen das Schloss gebaut war, ins Innere führte.
Kurz darauf schlüpfte er durch den Felsspalt, der von Weitem kaum sichtbar war. Der bekannte, feucht-modrige Geruch kroch in seine Nase. Johan zog die kleine Taschenlampe aus der Manteltasche, die er immer dabeihatte, wenn er hierherkam. Er schaltete sie ein und setzte seine Füße bewusst auf den felsigen Unter- grund. Manche der Steine waren rutschig, einmal war er gestürzt und hatte sich den Kopf angeschlagen. Seither war er viel vorsichtiger, denn er wusste genau: Wenn ihm hier drinnen etwas passierte, würde ihn niemals jemand finden.
Ein Schwarm Fledermäuse flatterte an ihm vorbei, eine von ih- nen streifte ihn mit ihrem Flügel. Johan zuckte zusammen. Über eine steinerne Treppe mit moosüberzogenen Stufen, auf denen er höllisch aufpassen musste, gelangte er in einen niedrigen Gang. Hier kam er nur gebückt vorwärts. Er richtete den Lichtkegel vor sich auf den Boden. Zunächst führte der Tunnel schnurgerade durch den Felsen. Nach mehreren Minuten machte er eine scharfe Biegung, hinter der eine zweite, deutlich längere Steintreppe lag. Ein weiterer Gang, dann erreichte Johan die Felsspalte, durch die er sich ins Innere des Schlosses quetschte.
Wenig später streunte er über das verlassene Gelände der Ruine. Ein angenehmes Prickeln schlängelte sein Rückgrat hin- auf. Er liebte es, zwischen den dicken Steinmauern zu wandeln, als befände er sich in einem früheren Jahrhundert. Mit seinen selbst genähten Lederschuhen, einem Wams und den Strumpf- hosen unter dem wollenen Mantel hätte er optisch gut ins Spät- mittelalter gepasst. Lediglich die Tattoos, die er wie Schmuck an verschiedenen Stellen seines Körpers und sogar im Gesicht trug, hätten ihn zu jener Zeit entlarvt.
Als Kind hatte er vom Zeitreisen geträumt und mit seinen Buntstiften unzählige Konzepte von Zeitmaschinen entworfen. Inzwischen befasste sich Johan mit anderen Dingen. Paranormale Phänomene waren seine große Leidenschaft. Dass es ihm noch nicht gelungen war, Kontakt zur Welt der verstorbenen Seelen aufzunehmen, ärgerte ihn. Das Aurasehen zu lernen war deutlich leichter gewesen. Dennoch versuchte er sich immer wieder an der Herausforderung des Seelenkontakts mit Toten: auf nächtlichen Friedhöfen und eben auch hier, in Schloss Borgholm, wenn die Tore für die Besucher geschlossen waren.
Heute war Neumond, eine gute Voraussetzung, um die spirituelle Welt zu betreten. Heute könnte es endlich klappen.
…
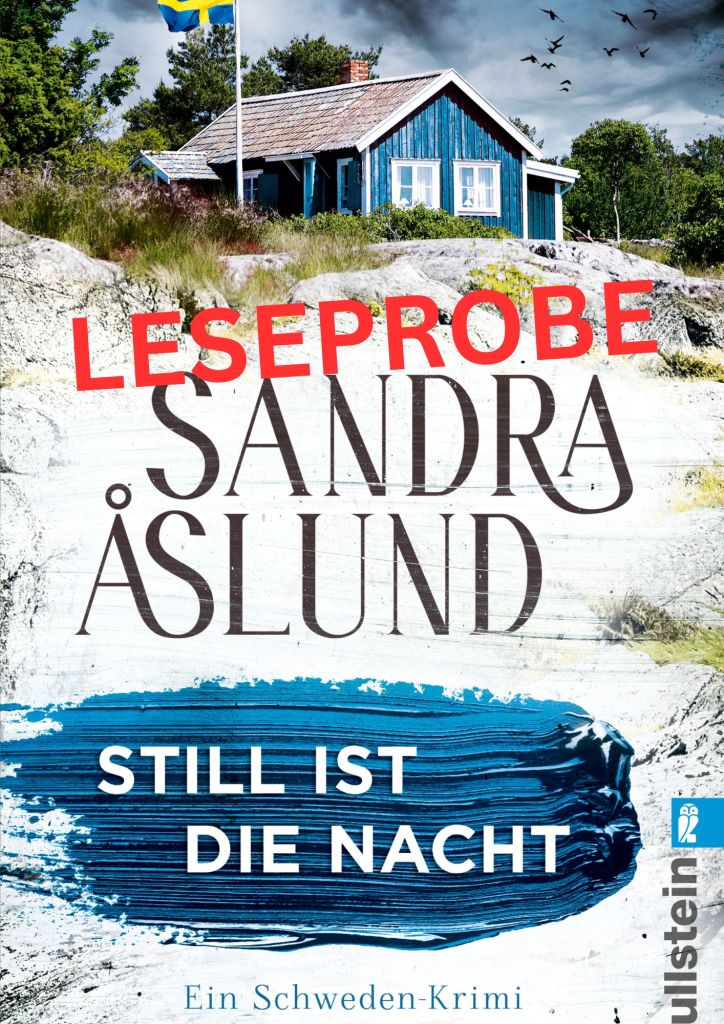
Prolog
Sonntag, 15. April
Zwei Reiher erhoben sich aus dem dichten Schilfgras und segel- ten mit bedächtigen Flügelschlägen übers Wasser davon. Charatha blieb stehen und sah ihnen nach, wie sie sich allmählich entfernten, am Uferstreifen entlang, in ihrem ganz eigenen Tempo. Frei und ungebunden, wie diese Tiere, so hatte sie immer sein wollen. Sofort dachte sie an Amita. Nicht umsonst trug sie diesen Namen: Amita, die Ungebundene, Grenzenlose. Charathas Herz füllte sich mit Wärme. War all das Warten und Hoffen am Ende doch nicht vergeblich gewesen?
Sie schloss die Augen und atmete tief und bewusst ein und aus. Die herrlich klare Meeresluft durchflutete ihre Lungen. Cha- ratha fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und genoss den sal- zigen Geschmack. Dass sie noch einmal in ihrem Leben auf diese Insel zurückkommen würde – sie hatte nicht damit gerechnet.
Einige Minuten lang richtete sie ihre Aufmerksamkeit nach innen und gab sich einer stillen Meditation hin, dann öffnete sie die Augen wieder und ließ ihren Blick über die einsame Bucht schweifen. An einem massigen Steinquader nahe der Wasser- kante blieb er hängen. Glatt geschliffen von den Wellen lag er dort genau wie ein Vierteljahrhundert zuvor. Als wäre die Zeit spurlos an ihm vorübergegangen. Was war die Dauer eines Menschenle- bens verglichen mit der Beständigkeit von Gestein?
Charatha lief hinüber, verharrte an dem kniehohen Felsen und fuhr bedächtig mit der Hand die Kuhle in der Mitte entlang. Ihre Sitzmulde, so hatte sie sie damals genannt. Sie erinnerte sich, wie sie im Sommer hier gesessen hatte, da war die harte, glatte Oberfläche von der Sonne gewärmt. Zum Glück trug sie ihr langes Strickkleid und einen dicken Wollschal, den sie als Sitzkissen unterlegte, ehe sie sich auf ihrem ehemaligen Lieblingsplatz niederließ.
Nach all den Jahren hatte Charatha vergessen, wie spät der Frühling in Schweden Einzug hielt. Bei ihrer Ankunft hatte sie bitterlich gefroren und am nächsten Tag ihre Reisegarderobe bei einem Bummel in der Stadt um einige warme Teile aufgestockt. Wie sehr sich Stockholm verändert hatte! Unzählige neue Geschäfte, Cafés und Restaurants … Sie hatte kaum etwas wiedererkannt.
Charatha seufzte auf. Vielleicht hätte sie lieber in Indien bleiben und das Stockholm ihrer Kindheit in Erinnerung bewahren sollen. Nun wurden diese Bilder unweigerlich überlagert von den frischen Eindrücken. Aber der Wunsch hatte sie nicht mehr losgelassen: Ein Mal noch wollte sie ihre Heimat sehen.
Gedankenversunken betrachtete sie ihre Hände, die in ihrem Schoß ruhten. Die blasse Haut spannte über den Knochen wie Pergament. Sie sahen aus wie die einer uralten Frau. Dabei war sie gerade mal Anfang vierzig.
»Regeln Sie Ihre Angelegenheiten, klären Sie, was zu klären ist«, hatte man ihr mit auf den Weg gegeben. Der Nachsatz »bevor es zu spät ist« hatte wie eine Prophezeiung in der Luft geschwebt.
Viel Zeit blieb ihr nicht. Ein paar Monate, meinten die Ärzte, maximal ein halbes Jahr. Wie ein hungriges Raubtier fraß sich der Krebs durch ihren Körper. Vergeblich hatte Charatha versucht, ihre Krankheit nicht als Feind zu betrachten, sondern als Chance, ihr bisheriges Dasein zu überdenken und neu auszurichten. In die innere Heilung zu gehen.
Letztlich hatte sie schlicht und ergreifend ihr Schicksal an- nehmen und die Tatsache akzeptieren müssen, dass sie in diesem Leben nicht bis ins hohe Alter auf Erden weilen würde.
Es gab noch so vieles zu erledigen, so vieles nachzuholen. Doch versäumte Jahre ließen sich nicht nachholen. Immerhin würde sie Amita bald wiedersehen.
Ein Segen, dass Deshaja eingewilligt hatte. »Aber lass uns erst mal allein treffen, nur du und ich.« Dass er ausgerechnet diesen Ort vorgeschlagen hatte – er hatte ihn also nicht vergessen, ihren ehemaligen Rückzugsort, an dem ihre Verbindung begonnen hatte.
Sie waren mit seinem Boot rausgefahren. Ihre Krankheit hatte sie ihm bisher verschwiegen. Sie wollte ihm in Ruhe davon erzählen.
Charatha sah an sich hinunter. Sie war immer schlank ge- wesen, nun bestand sie aus kaum mehr als Haut und Knochen. Auf den ersten Blick fiel es jedoch nicht auf. Diverse Kleidungsschichten kaschierten, wie abgemagert sie war, und bunte Tücher hatte sie sich bereits früher gern um den Kopf gewickelt. Vor der Krankheit, als sie noch ihre lange Haarpracht hatte.
Wo blieb bloß Deshaja? Er hatte Gläser aus der Hütte holen wollen – anstoßen mit Sekt, wie damals. Überhaupt war er ausge- sprochen liebenswürdig und zuvorkommend gewesen. Der Groll von einst, der ihn jahrzehntelang hatte schweigen lassen, schien zu guter Letzt verflogen.
Dabei hatte sie doch den Preis gezahlt. Den Preis, der viel zu hoch gewesen war, das hatte sie schon lange eingesehen. Nun, da sich ihr Leben dem Ende zuneigte, bereute sie, dass sie nicht frü- her über ihren Schatten gesprungen war. Aber jetzt gab es immerhin eine Chance, wenigstens ein bisschen wiedergutzumachen. Wenn sie morgen nach Stockholm zurückfahren würden, konnte sie endlich …
Schritte knirschten auf dem Kies, Charatha wandte den Kopf. Deshaja kam auf sie zu, er trug eine Kühlbox. Sie lächelte, sicherlich hatte er auch ein kleines Picknick eingepackt. Ganz wie damals, als sie ein Paar gewesen waren. Als die Welt noch bunt und verlockend daherkam, als die Zukunft ein unbeschriebenes Blatt war und alles möglich schien.
Langsam erhob sich Charatha, nahm den Wollschal vom Felsen und breitete ihn auf dem sattgrünen Frühlingsgras aus, so konnten sie nebeneinandersitzen und aufs Meer schauen.
»Förlåt, es hat etwas länger gedauert.« Deshaja stellte die Box neben ihr ab und öffnete den Deckel.
»Das macht nichts.« Charatha kniete sich hin und zupfte den Schal zurecht, dann drehte sie sich lächelnd zu ihm um. Sie er- starrte. Mit plötzlich aufwallendem Entsetzen betrachtete sie den Holzknüppel in seiner Hand. »Was – was hast du vor?«
»Denkst du wirklich, du kannst so einfach zurückkommen und alles auslöschen, was damals geschehen ist?« Verschwunden war jegliche Liebenswürdigkeit, sein Blick war von gnadenloser Härte. Er sah aus wie ein Fremder. Wie ein Feind.
Die pure Angst schoss in Charathas Magen, lähmte sie. »Des- haja, hör zu … Ich habe dir noch nicht alles erzählt, es ist …«
»Spar dir deine ewigen Erklärungen. Dein Bauchgefühl, dem du folgen musstest, um deinen Weg zu gehen. Es ging immer nur um dich.« Er stand direkt vor ihr, ließ den Knüppel leicht in seine linke Handfläche fallen. Sein Gesicht verzog sich zu einer grausigen Grimasse. »Das Einzige, was ich will, ist, dass du verschwindest! Ich lasse nicht zu, dass du noch einmal alles zerstörst!«
Du musst fliehen, wisperte eine Stimme tief in ihr, aber Charatha konnte sich nicht von der Stelle rühren. Jegliche Lebensenergie war aus ihrem geschwächten Körper gewichen. Ihr Mund war staubtrocken. Es war wie ein Albtraum, aus dem sie gleich erwachen würde. Er würde doch nicht wirklich …

Kapitel 1
Freitag, 26. Januar
Der Schulbus bremste und stoppte an den Zwillingsbirken. So nannte Frida die beiden mächtigen Bäume, die aus einem gemeinsamen Stamm wuchsen. Wie immer war sie die Letzte, die ausstieg. Richtige Haltestellen gab es auf der schmalen Landstraße nicht. Meistens hielt der Bus gleich vor den Häusern, in denen die Kinder wohnten. Fridas Zuhause lag jedoch ein Stück in den Wald hinein. Dort konnte ein so großes Fahrzeug nicht wenden.
»Tschüs, Frida, hab ein schönes Wochenende!«
»Tschüs, Pelle!« Frida schulterte ihren Rucksack und stieg aus. Sie mochte den glatzköpfigen Busfahrer, der immer ein nettes Wort für sie hatte. Ganz egal, welches Wetter war, sie hatte ihn selten schlecht gelaunt erlebt. Sein Markenzeichen waren seine Kopfbedeckungen. Sobald er von der Wollmütze zur Baseballkappe wechselte, war der Winter offiziell beendet. Leider oft erst Ende April. Bis dahin hatte sie noch einige dunkle Monate durchzustehen, in denen die dicke Schneedecke das Einzige war, was ein bisschen Helligkeit in die langen Stunden ohne Sonnenlicht brachte.
»Grüß deine Mutter von mir.« Pelle zwinkerte ihr zu, dann schlossen sich die Türen, und der Bus setzte sich in Bewegung.
An der nächsten Kreuzung würde er wenden und zurück nach Östersund fahren. Vorausgesetzt, er blieb nicht in den Schneemassen stecken, die die Räumfahrzeuge achtlos an den Straßenrändern zusammengeschoben hatten. So manchen Morgen wartete Frida eine kleine Ewigkeit auf Pelle, wenn er mal wieder die Hinterräder freischaufeln musste.
Er hatte ein Auge auf ihre Mama geworfen, das war Frida schon lange klar. Die Erwachsenen meinten zwar, Kinder würden solche Dinge nicht mitbekommen. Doch sie irrten sich. Bloß weil sie erst neun war, bedeutete das nicht, dass sie nicht begriff, was sich zwischen den Männern und Frauen um sie herum abspielte. Irgendwo hatte sie neulich den Ausdruck feine Antennen gehört. Das gefiel ihr. Ich habe feine Antennen für das, was zwischen den Menschen ist, dachte sie manchmal, wenn sie ihr Umfeld beobachtete. Dass sie von den Erwachsenen unterschätzt wurde, machte ihr nichts aus. Eigentlich passte es ihr sogar ganz gut. So konnte sie deren Verhalten ungestört studieren, ohne dass diese misstrauisch wurden.
Was Pelle betraf, war sich Frida allerdings sicher, dass Mama nicht an ihm interessiert war. Oft genug hatte sie betont, dass sie keinen Mann an ihrer Seite brauchte. »Nur wir beide. Das reicht doch, oder nicht? Haben wir es nicht gemütlich miteinander?«
Frida nickte dann immer. Natürlich hatten sie das. Und trotzdem – hin und wieder wünschte sie sich einen Familienalltag, wie ihre Freundinnen ihn hatten. Mama, Papa und mindestens zwei, drei Kinder. Ein großer Esstisch, beim Abendessen redeten alle durcheinander, es wurde gelacht und gescherzt. Bei Frida und ihrer Mutter war es still. Harmonisch, aber still. Doch diese Gedanken behielt sie für sich. Ihre Mutter hatte es eh schon schwer genug. Frida schämte sich für ihre geheimen Wünsche. Sie wusste, ihre Mutter hätte gern mehr Zeit mit ihr verbracht, anstatt Extraschichten im Büro der Holzfabrik zu schieben. Nur durch solche Überstunden konnten sie ab und zu verreisen.
Von der Landstraße bog Frida in einen Waldweg ein. Bei jedem Schritt knirschte der Schnee unter den Sohlen ihrer dick gefütterten Stiefel. Sie zog den Schal enger unter dem Kinn zusammen, band einen Knoten hinein und tastete in der Jackentasche nach dem Aventurin. Mama hatte ihn ihr zum ersten Schultag geschenkt. »Er ist der Schutzstein der Waage-Geborenen.« Mit diesen Worten hatte sie den grünen Stein auf Fridas Handfläche gelegt und ihr die Finger darum geschlossen. Er hatte sich glatt und überraschend warm angefühlt.
Alarmiert blieb Frida stehen. Wo war er heute? Hatte sie ihn in der Schule liegen lassen? Oder am Ende gar verloren? Ihr Herz schlug schneller, das durfte nicht sein! Auf diesen letzten Metern nach Hause, die sie durch den dichten Nadelwald zurücklaufen musste, hielt sie ihn doch immer fest in der Hand.
Sie kramte tiefer in der Tasche und atmete auf. Da war er. Rasch schloss sie ihre Faust um ihn und lief in den dunklen Wald hinein.
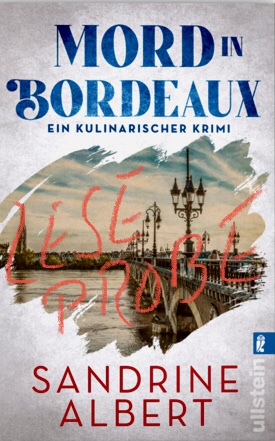
PROLOG – Mittwoch, 6. Februar 1952
Ist das ein Schrei gewesen? Mit einem Ruck setze ich mich im Bett auf, lausche in die Dunkelheit. Alles ist still. Vielleicht war es nur ein Traum? Ich lege mich wieder hin, suche meinen Teddy, drücke ihn an mich. Nur ein Traum.
Aber als ich die Augen schließe, höre ich es wieder. Es klingt wie ganz dolles Weinen. Ist das Mama? Ich habe Angst, verkrieche mich unter der Decke, bis ich fast keine Luft mehr bekomme. Das Schluchzen hört nicht auf. Ich presse mir die Hände auf die Ohren. Dann setze ich mich wieder hin. Was, wenn Mama Hilfe braucht? Ich will nicht aufstehen. Und doch schlage ich die Bettdecke zurück. Suche mit den Füßen nach meinen Hausschuhen. Sie sind kuschelig weich, die Wärme gibt mir Mut.
Ich tappe zur Tür, öffne sie ein kleines bisschen. Jetzt höre ich das Weinen ganz laut. Es kommt aus dem Schlafzimmer von meinen Eltern. Papa ist nicht da, er ist verreist wegen seiner Arbeit.
Langsam mache ich einen Schritt, dann noch einen. Und so weiter, bis ich an der angelehnten Schlafzimmertür stehe. Ich trau mich nicht, durch den Türspalt zu schauen. Vielleicht sehe ich dann was ganz Schlimmes. Aber es ist doch meine Mama, die da weint. Ich will sie trösten.
Vorsichtig linse ich durch den Spalt.

Der Schlag traf sie unvorbereitet mitten ins Gesicht. Sie taumelte rückwärts und schaffte es gerade so, nicht zu stürzen. Wie konnte er es wagen! Nie im Leben hätte sie damit gerechnet, dass er diese Grenze überschreiten würde. Nicht nach allem, was sie über seine Kindheit erfahren hatte, über seinen Vater.
Dann sah sie in seine Augen, die kurz zuvor noch so sanftmütig geblickt hatten, so treu ergeben. Entfesselte Wut blitzte ihr entgegen.
Sie hatte ihn völlig falsch eingeschätzt. Er hatte den einen Moment ausgenutzt, in dem sie nicht aufgepasst hatte.
Es war ein Fehler gewesen, sich so stark auf ihn einzulassen, ein Fehler, mit ihm herzukommen, in diese abgelegene Hütte auf einer Anhöhe. Ein idyllisches Wochenende zu zweit hätte es sein sollen, fernab von Bordeaux in malerischer Natur. Um sie herum nichts als Weinfelder und Wald, die nächsten Nachbarn weit entfernt. Keiner hörte sie, wenn sie schrie.
Sie musste hier weg. Sofort. Weg aus der Hütte, weg von ihm.
 PROLOG – Freitag, 6. Mai 1994
PROLOG – Freitag, 6. Mai 1994
Seidiges Haar, das mich an Feenzauber denken lässt. Sie sieht mich an, ohne eine Miene zu verziehen. Die Sekunden tröpfeln dahin, keine Reaktion. Hat sie mich nicht verstanden? Habe ich zu leise gesprochen? Oder zu undeutlich? Das wird mir ständig vorgehalten. Das Blut schießt mir in den Kopf. Wie ich das hasse! Ich würde sonst was dafür geben, wenn ich es kontrollieren könnte. So was von peinlich!
Seit Tagen habe ich darauf gelauert, sie allein anzutre en. Andauernd ist sie mit ihren Freundinnen zusammen. Bis auf freitags, die letzten beiden Stunden. Da hat sie Informatik. Ohne die Freundinnen. Ich habe den Kurs nur wegen ihr belegt. Nach der Pause habe ich sie abgepasst.
Und nun stehe ich hier wie ein Idiot. Alles fühlt sich falsch an.
Endlich bewegt sie ihre Lippen. »Ob ich mit dir zum Frühlingsfest gehe?« Ihre Augen ruhen auf meinen ammenden Wan- gen, auf die ich am liebsten meine Hände pressen würde.
Ich schlucke. Nicke. Die Zunge klebt am Gaumen. Meine Kehle ist trocken wie die Sahara.
PROLOG – Freitag, 5. Januar 1962
»Du bist raus.« Die Kunstdrucke an der Wand gegenüber verschwammen vor seinen Augen zu einem grellen Farbenbrei. Wie sollte es weitergehen? »Du bist raus und hast ab sofort nichts mehr mit uns zu tun. Die Papiere erhältst du mit der Post.«
Er fühlte einen Kloß im Hals und schluckte. Seit Jahren hatte er nicht geweint. Wann hatte er das letzte Mal seine Tränen auf den Wangen gespürt? Jetzt war er kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen! Es half nichts. Die Worte, die er eben vernommen hatte, hallten in seinen Ohren wider, füllten seinen Kopf aus, wanderten in seinen Körper und schwollen dort an, bis für nichts anderes Platz war.
»Du bist raus und allein für diese Dinge verantwortlich. Falls du dir überlegen solltest, etwas zu unternehmen, irgendwelche Maßnahmen ein- zuleiten – denk daran, du hast nichts gegen uns in der Hand.«
PROLOG
Das Schlucken fiel ihm schwer. Etwas steckte in seinem Mund, drückte seine Zunge nach unten. Er konnte den Mund nicht öffnen. Arnaud versuchte sich zu bewegen. Es funktionierte nicht. Er lag auf der Seite. Seine Hände waren auf den Rücken gebunden. Seine Schultern, seine Knie, alles tat ihm weh. Die Beine ließen sich nicht strecken, sie waren schmerzhaft weit nach hinten gebogen. Die Füße hinten gefesselt. Harter Boden unter ihm. Dunkelheit um ihn herum.
Ganz allmählich schälten sich Konturen aus der Schwärze. Vor seinen Augen erschien eine Mauer. Alte Steine. Den Kopf konnte er ein wenig bewegen. Wenn er ihn nach oben drehte, konnte er Schemen einer hohen Steindecke ausmachen. Er hatte keine Ahnung, wo er war. Wie er hierher gekommen war. Er wand sich in den Fesseln, um sie ein Stückchen zu lockern. Umsonst. Die allerkleinste Bewegung der Beine zerrte an seinen Händen.